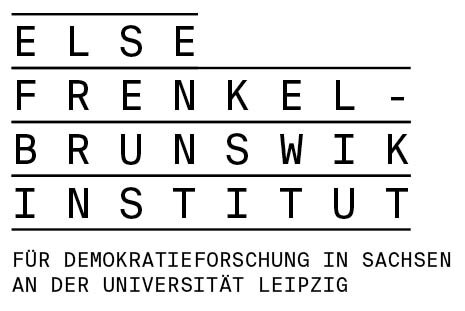Das Else-Frenkel-Brunswik-Institut
Institut für Demokratieforschung
Das Else-Frenkel-Brunswik-Institut (EFBI) wird als eigenständige Forschungseinheit im interdisziplinären Zentrum der Universität Leipzig »Leipzig Research Centre Global Dynamics« etabliert und administrativ angebunden. Seit Herbst 2020 wird es aus Mitteln des Freistaates gefördert. Geleitet wird das Else-Frenkel-Brunswik-Institut vom bundesweit renommierten Sozialforscher Oliver Decker, der unter anderem auch für die Leipziger Autoritarismus-Studien verantwortlich zeichnet.
Zielsetzung
Einen besonderen Stellenwert nimmt für das EFBI die enge Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen und universitären Akteurinnen und Akteuren ein, die bereits seit langem in Sachsen in der Demokratiearbeit und -forschung wirken. Das EFBI versteht seine Aufgabe als zusätzliches Angebot zum bereits Bestehenden, um gegebenenfalls Lücken zu schließen beziehungsweise passgenauere Lösungsansätze, insbesondere für den ländlichen Raum, bereitzustellen. Damit will es einen Beitrag dazu leisten, die Zivilgesellschaft in den Regionen konstruktiv, erfolgreich und nachhaltig zu stärken.
Ziel des EFBI ist es, wissenschaftlich fundierte Informationen zu demokratiefeindlichen Einstellungen, Netzwerken, Akteurinnen und Akteuren bereitzustellen. Diese Informationen werden aufbereitet und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Insbesondere Kommunen können davon profitieren, genauso wie zivilgesellschaftliche Vereine, Verbände und Stiftungen, die sich für ein friedliches Miteinander und gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzen. Diese gesellschaftlichen Akteurinnen, Akteure und Strukturen sollen zudem durch die Forschung des EFBI gestärkt werden: Wissenschaftliche Studien nehmen bestimmte Regionen in den Fokus und untersuchen, wie sich zivilgesellschaftliches Engagement demokratiefeindlichen Bestrebungen entgegenstellt.
Arbeitsbereiche
Antidemokratische und demokratiefeindliche Netzwerke, Akteur:innen und Narrative sollen dokumentiert werden, um wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse gewinnen zu können. Schwerpunkt sind hier die Sozialen Medien, die ein hohes Mobilisierungspotential haben. Die Beobachtung ("Monitoring") vor allem des rechtsextremen Spektrums erfolgt in Kooperation mit verschiedenen Partner:innen, die entsprechende Tools bereits erfolgreich einsetzt. Zum anderen werden bereits bestehende Sammlungen von Daten und Ereignissen zivilgesellschaftlicher Akteur:innen im Freistaat Sachsen zusammengeführt und systematisiert. Diese Dokumentation bildet eine Grundlage für die anderen Arbeitsbereiche des EFBI.
Um ein umfängliches Bild des Wirkens der Akteur:innen vor Ort zu zeichnen, ist die qualitative (kollektive) Autobiographieforschung ein wesentlicher Aufgabenschwerpunkt des EFBI. Ziel dieses partizipativen Ansatzes ist es, die Bedeutung des Handelns von Akteur:innen im Alltag zu verstehen und daraus Rückschlüsse auf die Bedingungen demokratisch-politischen Handelns zu ziehen, aber auch autoritäre Mobilisierungsstrategien zu erkennen und Handlungsoptionen gegen diese herauszuarbeiten. "Expert:innen ihres Alltags" werden bei der Formulierung der Forschungsfragestellungen einbezogen und die gewonnenen Erkenntnisse in gemeinsamen Auswertungsrunden überprüft. Letztlich geht es darum, die Handlungsfähigkeit der zivilgesellschaftlichen Akteur:innen und damit die Wirksamkeit von Projekten vor Ort zu erhöhen.
Die Erkenntnisse aus der oben beschriebenen Dokumentation und aus der Autobiographieforschung bilden die Grundlage für die Einstellungsforschung, welche den dritten großen Aufgabenbereich des EFBI beschreibt. Zum einen werden hier bereits bestehende Daten (z.B. aus der Leipziger Autoritarismusstudie oder voraussichtlich dem Sachsen-Monitor) ausgewertet. Zum anderen werden repräsentative Bevölkerungsumfragen durchgeführt, die einen passgenauen Blick auf autoritäre und antidemokratische Einstellungen in der sächsischen Bevölkerung ermöglichen. Die Ergebnisse dieser Forschung werden nicht nur den zivilgesellschaftlichen Akteur:innen vor Ort, sondern der interessierten Öffentlichkeit allgemein zur Verfügung gestellt.
Das Informations- und Beratungsangebot des EFBI leistet einen Beitrag der "Hilfe zur Selbsthilfe": Mittels geeigneter Informationen sollen Probleme eigenständig vor Ort gelöst werden können. Bereits bestehende Beratungsangebote sollen ergänzt und durch geeignete Informationen und Handreichungen gestärkt werden.
Zusammenarbeit mit anderen Forschungsstellen
Demokratieforschung bundesweit
Da antidemokratische Bewegungen nicht an den Landesgrenzen enden, ist der Austausch und die Vernetzung zwischen Forschungseinrichtungen und Hochschulen, die in diesem Themenbereich arbeiten, von herausragender Bedeutung. Das EFBI kooperiert daher u.a. mit folgenden Institutionen:
- Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft (IDZ)
- Zentrum für Rechtsextremismusforschung, Demokratiebildung und gesellschaftliche Integration an der Universität Jena
- Emil Julius Gumpel Forschungsstelle am Moses Mendelssohn Zentrum Potsdam
- Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt (FGZ)
Forschungs- und Wissenstransfer in Sachsen
Das EFBI steht in engem Austausch mit anderen sächsischen Forschungseinrichtungen, die sich mit den Themenbereichen Demokratie, Politische Bildung und Autoritarismus beschäftigen.
Wer war Else Frenkel-Brunswik?
Else Frenkel wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Lemberg, heute Lwiw, Ukraine, geboren. In Folge von Pogromen und des Antisemitismus übersiedelte ihre jüdische Familie 1914 nach Wien, wo sie aufwuchs, nach der Matura ein Studium der Mathematik und Physik begann und ein Studium der Psychologie anschloss. Nach dem Studium war sie am Institut für Psychologie im Forschungsbereich »Autobiographische Forschung« beschäftigt. Nach dem Einmarsch Nazi-Deutschlands in Österreich floh Else Frenkel 1938 in die USA und begann an der University of California in Berkeley ihre Tätigkeit als Senior Lecturer. In den USA heiratete sie den ebenfalls aus Wien emigrierten Egon Brunswik. Else Frenkel-Brunswiks Forschungsschwerpunkt wurde der Antisemitismus, und sie war maßgeblich an den ab 1944 in Berkley durchgeführten »Studies in Prejudice« beteiligt. Sie leitete neben dem ebenfalls in die USA ausgewanderten Sozialphilosophen Theodor W. Adorno, dem Sozialpsychologen Nevitt Sanford und dem Psychiater Daniel J. Levinson die Studien »The Authoritarian Personality«. Mit der Benennung des Instituts schließen die Leipziger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an die von ihr mitbegründete Tradition der Vorurteilsforschung an.